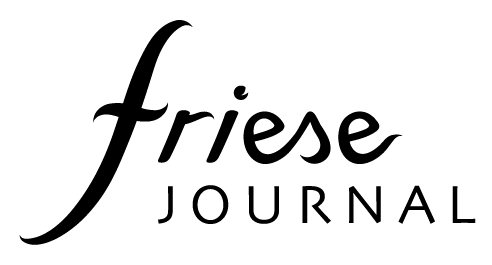Am Dienstag, 6. Mai 2025, verlegte der Verein „Stolpersteine für Dresden e.V.“ mehrere neue Stolpersteine in der Dresdner Friedrichstadt.
Neue Stolpersteine auf der Schäferstraße
Um 13.00 Uhr fand die erste Verlegung von neuen Stolpersteinen statt. Die Steine wurden vor dem Haus Schäferstraße 17 in den Boden eingelassen und erinnern an Helene und Walter Hempel. Das Ehepaar wohnte gegenüber im Haus Schäferstraße 16. Dort befindet sich aber derzeit eine Grünanlage und die Stolpersteine haben daher ihren Platz auf der anderen Straßenseite bekommen.

Stolperstein für Helene Hempel
Der Stolperstein für Helene Hempel trägt folgende Inschrift:
HIER WOHNTE
HELENE HEMPEL
GEB. GANENZ
JG. 1893
ZEUGIN JEHOVAS
SEIT 1936 MEHRMALS
VERHAFTET
ZULETZT 16.11.1943
MÜNCHEN-STADELHEIM
ENTLASSEN 26.4.1945
Mehr über Helene Hempel
Helene Hempel wurde 1893 in Wulkow geboren und arbeitete zunächst als Haushaltshilfe. 1918 heiratete sie Walter Hempel und bekam zwei Töchter, die Familie zog 1920 nach Dresden. 1927 kam sie mit den Zeugen Jehovas in Kontakt und ließ sich taufen. Nach dem Verbot der Religionsgemeinschaft praktizierte sie ihren Glauben im Untergrund weiter. Sie beteiligte sich an Flugblattaktionen gegen das NS-Regime und wurde verhaftet und inhaftiert. Nach dem Krieg lebte sie wieder in Dresden und wurde zunächst als „Opfer des Faschismus“ anerkannt. Nach neuerlicher Verfolgung der Zeugen Jehovas in der DDR floh sie 1956 nach München, wo sie später starb.
Stolperstein für Walter Hempel
Der Stolperstein für Walter Hempel trägt folgende Inschrift:
HIER WOHNTE
WALTER HEMPEL
JG. 1895
ZEUGE JEHOVAS
SEIT 1934 MEHRMALS
VERHAFTET
ZULETZT 16.11.1943
TODESURTEIL 13.12.1944
VOLKSGERICHTSHOF
KZ DACHAU
BEFREIT
Mehr über Walter Hempel
Walter Hempel wurde 1895 in Dresden geboren, lernte den Beruf des Schneiders und führte ein eigenes Geschäft. 1918 heiratete er Helene Ganenz, mit der er zwei Töchter hatte, und lebte ab 1920 in Dresden. In den 1920er-Jahren war er politisch aktiv in der SPD und trat später mit seiner Familie den Zeugen Jehovas bei. Trotz des Verbots der Religionsgemeinschaft praktizierte die Familie weiterhin ihren Glauben. Walter Hempel wurde mehrfach verhaftet, erstmals 1934 und erneut 1935, wegen religiöser Aktivitäten wie dem Verbreiten von Bibeln. 1937 verurteilte ihn das Sondergericht zu 18 Monaten Haft, die er in Schloss Hoheneck verbüßte.
Während des Zweiten Weltkriegs betätigten sich Walter und Helene als Kuriere für verbotene religiöse Schriften, wofür sie 1943 verhaftet wurden. 1944 wurde Hempel vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt, jedoch im Mai 1945 von amerikanischen Truppen auf dem Weg ins KZ Dachau befreit. 1950 wurde er in der DDR erneut wegen seines Glaubens verurteilt und verbrachte weitere Jahre in Haft. Nach seiner Entlassung 1956 floh er nach München zu seiner Familie, wo er 1967 verstarb.
Weiterführende Informationen und auch Bilder der Familie sind auf der Seite https://alst.org/aktuelles/sechs-stolpersteine-fuer-eine-mutige-familie-aus-dresden/ zu entdecken.
Impressionen von der Verlegung der Stolpersteine



Weitere Stolpersteine für Margarete Schreiber und Familie Schäfer/Weigoldt
Ein weiterer Stolperstein für Margarete Schreiber wurde an der Freiberger Straße 43 neu verlegt. Der Stein war 2024 gestohlen worden. Anschließend fand eine weitere neue Verlegung an der Freiberger Straße 6 statt. Die Steine sind der Familie Schäfer/Weigoldt gewidmet. Da der Wohnort Palmstraße 37 nicht mehr existiert, wurde der Stein an der Freiberger Straße verlegt.