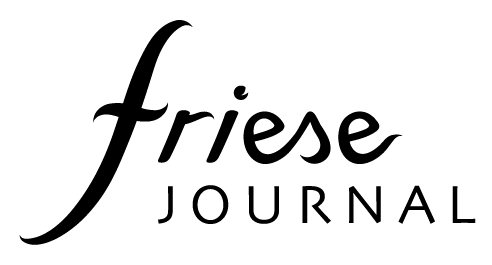Was passiert, wenn eine architektonische Ikone ihre ursprüngliche Bestimmung verliert und Studierende ihr eine Zukunft geben sollen?

Deconstruct Deconstructivism
Was bleibt von der Ikone, wenn man sie auseinander nimmt?
Der Titel klingt nach Abrissbirne, tatsächlich geht es um etwas viel Feineres. Am Donnerstag, dem 13. November, um 16 Uhr lädt das Zentrum für Baukultur im Kulturpalast zur Führung durch die Ausstellung „Deconstruct Deconstructivism“. Verantwortlich dafür sind die Fakultät Architektur und Landschaft der TU Dresden sowie der Design Campus des Kunstgewerbemuseums. Wissenschaftlicher Mitarbeiter Felix Beyer führt gemeinsam mit den Diplomandinnen und Diplomanden durch die Projekte. Eine seltene Gelegenheit, Studierenden einmal beim Denken über die Schulter zu schauen, bevor ihre Ideen in den Schubladen der Realität verschwinden oder – im besten Fall – irgendwann Stadtbild werden.

Von der großen Geste zur klugen Weiterentwicklung
Transformation ist das Zauberwort unserer Zeit. Die Architektur steckt in derselben Zwickmühle wie wir alle: Weniger Ressourcen, weniger Platz, mehr Anforderungen. Statt futuristischer Neubauten, die sich auf Renderings gut machen und hinterher wie eingefrorene Design-Entscheidungen herumstehen, richtet sich der Blick wieder auf das, was schon da ist. Denn das Umnutzen und Weiterdenken von Gebäuden spart Material, Energie und meist auch Nerven. Wer einmal in Dresden versucht hat, zeitgenössische Architektur genehmigt zu bekommen, weiß warum.
Die Ausstellung zeigt die Diplomarbeiten des Sommersemesters 2025 und beschäftigt sich mit einem Objekt, das kaum jemand übersehen kann und trotzdem oft unbeachtet bleibt: der Dresdner Kristallpalast.
Der Kristallpalast – Ikone mit Identitätskrise
1998 als Kinokomplex gebaut, getragen vom damaligen Optimismus, dass der städtische Kinosaal dem Wohnzimmer auf Dauer Paroli bieten könnte. Die Realität war weniger romantisch. Streamingdienste haben den Kampf gewonnen, der Kristallpalast steht groß, kühn und unterfordert in der Landschaft. Coop Himmelb(l)au schufen ein Gebäude, das für die 1990er alles hatte: Kanten, Glas, Mut zum Übertreiben. Heute stellt sich die Frage, was man mit einer Ikone tut, die zwar markant, aber unbrauchbar geworden ist. Entglasen? Umbauen? Neu erfinden?
Genau dort setzen die Studierenden an. Statt den Palast mit dem Presslufthammer aus dem Stadtgedächtnis zu tilgen, zeigen sie, wie Umnutzung funktionieren könnte: als Kunstgewerbemuseum, als Design Campus, als Raum für neue Öffentlichkeit. Transformationsprozesse werden dabei nicht als radikale Tabula rasa verstanden, sondern als Weiterentwicklung, die Qualitäten bewahrt und gleichzeitig neue Bedürfnisse aufnimmt.
Architektur als Prozess, nicht als Endzustand
Die Projekte erzählen von einem Verständnis von Architektur, das sich Zeit nimmt. Gebäude altern, Städte verändern sich, Nutzungen wandern. Wer heute plant, baut nicht mehr für die Ewigkeit, sondern für ein Morgen, das flexibel bleibt. Das klingt bodenständig, ist aber im Kern ziemlich revolutionär. Denn es bedeutet, Abschied vom Mythos der genialen, unantastbaren Form zu nehmen.
Die Ausstellung im Kulturpalast zeigt, wie diese Denkweise in der Praxis aussehen kann. Keine fertigen Antworten, aber kluge Fragen. Und wer entscheidet, wie eine Stadt in Zukunft funktioniert, wenn nicht diejenigen, die jetzt ausgebildet werden.
Warum sich ein Besuch lohnt
Die Führung ist nicht nur für Architekturkenner interessant. Sie zeigt, wie unsere Stadt weitergedacht werden könnte, statt in nostalgischer Starre festzuwachsen. Und sie erinnert daran, dass Transformation mehr bedeutet als neue Farbe auf alten Wänden. Wer neugierig ist, wie aus einer Ikone mit Staubschicht ein Ort mit Zukunft werden kann, dürfte hier auf seine Kosten kommen.
Donnerstag, 13. November, 16 Uhr, ZfBK im Kulturpalast. Eintritt frei, Gedanken inklusive.